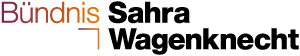Posted on
12. April 2023
in
Nach Corona hat sich die Debattenkultur in Deutschland nie erholt
Gastbeitrag von Alexander King, Berliner Zeitung
Während Corona verunglimpften Teile der Medien und Politik impfskeptische Bürger, nun ist es mit Friedensaktivisten so. Die Politik ignoriert zahlreiche Stimmen.
Tags: Corona
Related posts
18. April 2024
Warum so viele Flüchtlingsunterkünfte in Ost Berlin?
Bei der Verteilung des Senats von Flüchtlingen in den Kiezen spielen in der Regel kaum die soziale [...]
Read more16. April 2024
ÖRR unter Druck: Trotz Diffamierung darf das Mitarbeiter Manifest nicht…
ÖRR unter Druck: Trotz Diffamierung darf das Mitarbeiter-Manifest nicht im Sand verlaufen. Das [...]
Read more15. April 2024
Von FDP zu BSW: Kriegsverweigerer Christian Schuchert
Aktuell gebe es in Berlin 55 BSW-Mitglieder, noch vor den Sommerferien werden es 80 sein, erklärt der [...]
Read more8. April 2024
Berliner FDP-Politiker wechselt wegen Strack-Zimmermann zu Wagenknecht
„Mit Herrn Schuchert ist das BSW jetzt auch in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf und damit [...]
Read more